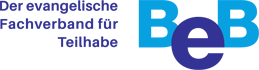Gewalt?
Alex Kauk
Als ich angefragt wurde, zum Heftthema einen Beitrag im Hinblick auf das Autismus-Spektrum zu schreiben, war ich erfreut, hing aber zugleich an dem Begriff Gewalt fest.
Auch wenn Autist*innen, schon aufgrund des Problems, ihr Gegenüber einschätzen zu können, oft Opfer von Gewalt jeglicher Art werden, ist Gewalt ein Begriff, der einem stetigen Wandel unterzogen ist. Er wird zum Teil synonym mit Aggression verwendet (beim Thema Aggression wird bei Autist*innen leider meist als Aggressor gedacht), bis hin, dass Gewalt eine bewusste Entscheidung benötige, einem Menschen zu schaden. Der Begriff Gewalt ist nicht mal rein negativ bewertet, wenn man an Begriffe wie Staatsgewalt denkt.
Auch im Bereich Autismus wird heute anders gewertet als noch vor z.B. 10 Jahren. Die Festhaltetherapie z.B. galt eine Zeit lang als sinnvoll mit der Überzeugung, Autist*innen damit zu helfen, und erst später wurde erkannt, wie schädlich sie war. Ähnliches zeichnet sich zum Glück mittlerweile auch für Therapien wie ABA ab.
Daher möchte ich hier auf die einzige Konstante des Begriffes eingehen, nämlich, dass einer Person geschadet wird, unerheblich, ob dies von außen beabsichtigt war oder nicht. Eine Sensibilisierung auf eine potenzielle Schädigung einer Person ist m.E. die einzig wirksame Strategie, um sich in der Arbeit mit Menschen jeglicher Diversität präventiv weiterzuentwickeln.
Menschen schaden sich permanent gegenseitig, schon durch die meist vorherrschende Inkompatibilität ihrer Bedürfnisse.
Aber wie ist das, wenn man auch noch einer Minderheit angehört, deren Wahrnehmung und Bedürfnisse teilweise doch massiv von der Mehrheit abweichen?
Wie kann ich als Fachkraft in der Arbeit mit Autist*innen vermeiden, unbeabsichtigt zu schaden?
Und von welchem Schaden spreche ich hier überhaupt?
Dazu ein Beispiel von mir, einer 54jährigen Autistin, die meist von ihrem Umfeld als kompetent und fast „normal“ empfunden wird (Masking sei Dank).
Ich war bei einem Event, auf das ich mich sehr gefreut hatte. Die Örtlichkeit war mir vertraut, noch dazu waren Bezugspersonen vor Ort, die immer Sicherheit boten.
Nun waren aber aus Sicherheitsgründen Änderungen vorgenommen worden, von denen ich nichts wusste. Ich fand mich auf einem für mich völlig veränderten Event wieder, meiner bekannten Fluchtwege beraubt und unfähig, meine Bezugspersonen vor Ort zu finden.
Aus einem geplanten längeren Besuch wurde ein kurzer mit dem Glück es noch nach Hause geschafft zu haben, ohne im Meltdown in der Menschenmasse - in der niemand Rücksicht darauf nahm, mich NICHT zu berühren - aus Verzweiflung, um mich zu schlagen (mein persönlicher „Worst Case“ und größte Angst, da ich dann der Aggressor gewesen wäre).
Zu Hause angekommen, brach es aus mir heraus. Der verzweifelt aufgeschobene Overload endete im Meltdown mit Autoaggression. Diese kommt zum Glück nur noch selten vor, aber wenn Alles in mir „zerspringt“, die ganzen äußeren Eindrücke unkontrolliert in mir geballt Zerstörung anrichten, ist dies manchmal die letzte Möglichkeit für mich, wieder Kontrolle über mich zu erhalten. Indem ich das fühle, was ICH kontrollieren kann, bzw. indem ich MICH fühle. Nach dem Meltdown folgten zwei Tage meiner Lebenszeit, in denen ich handlungsunfähig war und regenerieren musste.
Hat es mir geschadet?
Ja.
Hatte jemand Schuld?
Nein.
Wäre es vermeidbar gewesen?
Eine Vorwarnung hätte mich vorbereiten lassen können, aber dazu hätte mein Umfeld erst wissen müssen, welche Konsequenzen das für mich hat (Masking eben keinen Dank).
Diese Welt ist voll von Veränderungen und Herausforderungen, die oft selbst für Nichtautist*innen belastend sind.
Können Sie Autist*innen schützen?
Unwahrscheinlich.
Was können Sie tun?
- Ich rate in meiner Arbeit immer dazu, Strukturen oder Pläne realistisch bezüglich ihrer Umsetzbarkeit einzuführen. Je mehr Sicherheiten Sie anbieten, umso mehr können plötzlich wegbrechen, was i.d.R. schlimmere Konsequenzen hat.
- Der Autopilot des Gehirns neigt dazu, Situationen nach dem eigenen Empfinden allgemeingültig zu bewerten. Ist eine Situation für Sie belanglos, kann sie für Autist*innen katastrophal sein. Bitte versuchen Sie sich dies so oft wie möglich bewusst zu machen.
- Und letztendlich, so banal es klingen mag, entwickeln und vor allem zeigen Sie Empathie. Wenn Autist*innen von ihrem Verhalten auffällig werden, steckt meist eine vorausgegangene Überlastung durch das Umfeld dahinter. Sehen Sie dies als Reaktion und Hilferuf und nicht als eine Herausforderung an Sie.
Ich wollte nie jemanden herausfordern, auch wenn es so wirkte. Mir war immer bewusst, dass ich mit Dingen Probleme hatte, mit denen alle anderen keines hatten. Das machte meine Probleme unsichtbar und diskreditierten mich vor mir selbst, was mein Verhalten nach außen hin noch „herausfordernder“ machte.
Was mir bis heute hilft ist verbalisiertes Verständnis meines Umfeldes, um meine Probleme zu legitimieren und endlich anzunehmen, dass auch ich Schwächen UND Stärken habe wie jeder andere Mensch auch.
Alex Kauk
Peerberatung Autismus
Bathildisheim e.V.